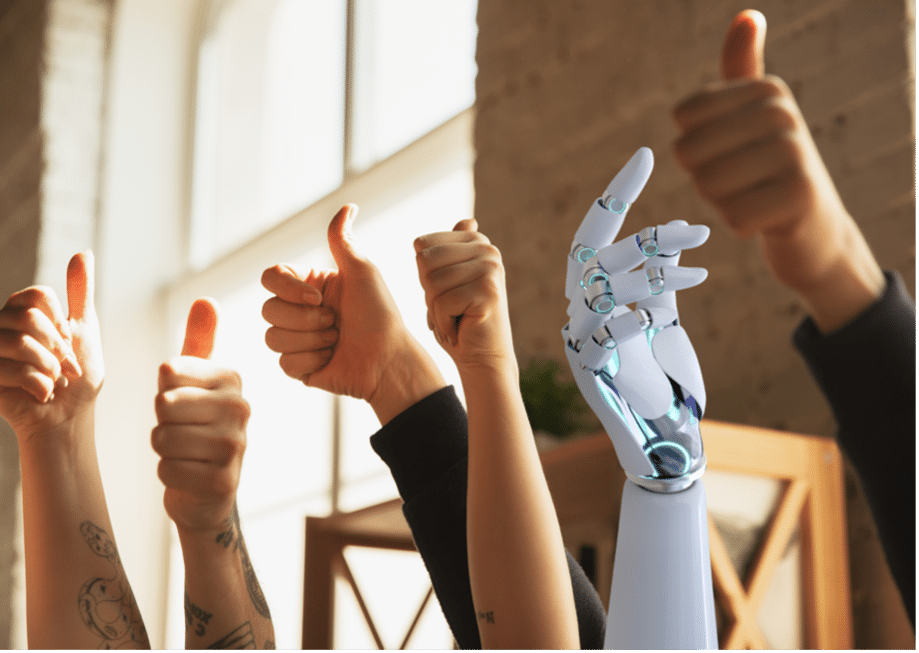Vor kurzem saß ich mit dem Betriebsrat eines mittelgroßen Unternehmens zusammen. Unser Workshop-Thema: Einführung einer neuen KI-Anwendung. Die Diskussion startet verhalten, bis einer offen sagt: „Ehrlich, ich weiß gar nicht genau, was die KI macht und ob ich sie gut finden soll. Ich mache doch hier was für und mit Menschen. Und wer weiß, was damit wieder optimiert und rationalisiert werden soll“.
Da war er, der Moment, den ich in so vielen Unternehmen erlebe: Wir reden über Technik, aber es geht eigentlich um Vertrauen, Transparenz und Mitsprache.
Genau hier liegt die Aufgabe des Betriebsrats.
Genau hier wird klar: KI-Einführung ist nicht nur ein IT-Projekt, sondern ein Kultur- und Kommunikationsthema. Und es ist auch eine Frage des Arbeitsrechts. Deshalb habe ich die zehn wichtigsten Fragen zusammengestellt, die Betriebsräte sich und ihren Sparringspartnern – also den Arbeitgebern und Mitarbeitenden – jetzt stellen sollten.
1. Welche Rolle spielt der Betriebsrat bei der Einführung von KI im Unternehmen?
Der Betriebsrat hat eine zentrale Rolle, wenn KI in den Arbeitsalltag integriert werden soll. Er ist nicht nur Mitbestimmungsorgan, sondern auch Schutzinstanz. Nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG hat er ein zwingendes Mitbestimmungsrecht bei der Einführung technischer Einrichtungen, die das Verhalten oder die Leistung von Beschäftigten überwachen können – und dazu zählt KI in fast allen Fällen. Entscheidend ist: Der Betriebsrat muss frühzeitig eingebunden werden, um aktiv mitzugestalten und nicht bloß zu reagieren. Seine Rolle ist es, für Transparenz zu sorgen, Fragen zu stellen und sicherzustellen, dass Menschlichkeit, Fairness und Datenschutz nicht unter die digitalen Räder geraten. Denn: Technik darf nie den Takt vorgeben. Sie muss dem Menschen dienen, nicht umgekehrt.
2. Was besagt die KI-Verordnung in der betrieblichen Mitbestimmung?
Die EU-KI-Verordnung (AI Act), die 2024 verabschiedet wurde, stuft KI-Systeme nach Risikoklassen ein (Vergleich auch ein Blogartikel zur KI-Verordnung als Möglichkeitenraum: https://britta-redmann.de/arbeitsrecht/die-ki-verordnung-als-moeglichkeitenraum/).
Für Unternehmen bedeutet das: Wenn ein KI-System in der Arbeitswelt zum Einsatz kommt, etwa bei Bewerbungsverfahren oder Leistungsbewertung, gelten hohe Anforderungen inklusive Transparenz, Dokumentationspflichten und menschlicher Kontrollinstanzen. Für die Mitbestimmung ist das ein klares Signal: Der Betriebsrat muss einbezogen werden, sobald ein „Hochrisiko“-KI-System eingeführt wird. Zwar regelt die Verordnung nicht direkt das deutsche Mitbestimmungsrecht, aber sie stärkt es indirekt.
Die Verantwortung für faire Systeme und menschenzentrierte Umsetzung liegt dabei klar beim Arbeitgeber und der Betriebsrat wird zum wichtigen Partner bei der Sicherstellung dieser Standards.
3. Welche Kontrollmöglichkeiten hat der Betriebsrat?
Der Betriebsrat hat verschiedene Instrumente, um den Einsatz von KI zu kontrollieren. Zentral ist das Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG. Es greift immer dann, wenn KI zur Überwachung von Verhalten oder Leistung eingesetzt wird, sei es bei der Zeiterfassung, bei Performance-Analysen oder im Bewerbermanagement. Darüber hinaus kann der Betriebsrat nach § 80 BetrVG Informationen vom Arbeitgeber einfordern, wenn KI-Systeme eingeführt oder verändert werden.
Wichtig ist: Kontrolle heißt nicht Blockade. Sie bedeutet, gemeinsam Leitplanken zu entwickeln, die Innovation ermöglichen, ohne Rechte zu verletzen. Und gerade weil viele KI-Systeme intransparent sind, ist es umso wichtiger, dass der Betriebsrat sich selbst fit macht – um auf Augenhöhe mitreden zu können.
4. Wie wird Datenschutz bei KI-Einsatz gewährleistet?
Datenschutz ist beim Einsatz von KI kein „Kann“, sondern als ein Muss geregelt u. a. in der DSGVO (Art. 6, 35) und im BDSG. KI darf nur Daten verarbeiten, wenn eine klare Rechtsgrundlage besteht und die Grundsätze der Datenminimierung, Zweckbindung und Transparenz eingehalten werden. Wichtig ist dabei auch die Technologiefolgenabschätzung: Neben dem reinen Datenschutz muss geprüft werden, ob die KI fair, diskriminierungsfrei und nachvollziehbar arbeitet – Stichwort Bias-Vermeidung. Der Betriebsrat hat hier Mitbestimmungsrechte nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG und kann verlangen, dass entsprechende Prüfprozesse und Schutzmaßnahmen schriftlich fixiert werden. Eine gute Betriebsvereinbarung sollte zudem regeln, wie oft diese Überprüfung erfolgt und wie transparent die Ergebnisse kommuniziert werden sowohl an die Belegschaft wie auch an den Betriebsrat.
5. Wie kann der Betriebsrat faire Behandlung sicherstellen, wenn KI eingesetzt wird?
Fairness beginnt mit Transparenz und beinhaltet vor allem ganz viel Verantwortung. Der Betriebsrat sollte daher nicht nur auf technische Parameter schauen, sondern auch auf die Frage:
– Behandelt das System alle Beschäftigten gleich?
– Werden etwaige Verzerrungen erkannt und behoben?
Wichtig ist, dass algorithmische Entscheidungen (z. B. bei Leistungsbewertungen oder Boni) nicht automatisch und kritiklos übernommen werden. Der Mensch muss das letzte Wort haben. Betriebsvereinbarungen, die Standards für Fairness, Prüfintervalle und Kontrollrechte definieren, sind hier Gold wert.
Eine gute Feedbackkultur hilft, blinde Flecken aufzudecken. Faire KI ist kein Zufall. Sie entsteht durch bewusste Gestaltung und gemeinsames Hinschauen.
6. Wie sichert der Arbeitgeber die KI-Kompetenz der Betriebsräte?
Die Sicherung der KI-Kompetenz ist keine Kann-Vorschrift, sondern eine gesetzliche Pflicht: Nach § 37 Abs. 6 BetrVG muss der Arbeitgeber den Betriebsrat für erforderliche Schulungen freistellen und die Kosten übernehmen inklusive Reisekosten und Arbeitsausfall. Bei KI-Themen heißt das: nicht nur Tool-Bedienung schulen, sondern auch rechtliche, ethische und organisatorische Aspekte vermitteln.
KI-Verständnis umfasst technische Grundlagen, aber auch die Fähigkeit, Risiken wie Datenschutzverletzungen, Bias oder Überwachungsrisiken zu erkennen. Idealerweise wird ein (dauerhaftes und turnusmäßiges) Schulungskonzept gemeinsam mit externen Experten entwickelt, um die Kombination aus juristischem, technischem und kulturellem Wissen sicherzustellen.
Nur so kann der Betriebsrat auf Augenhöhe mit dem Arbeitgeber an zukunftsfähigen Lösungen arbeiten.
7. Wie können Betriebsräte mit KI-Experten zusammenarbeiten?
Betriebsräte müssen nicht selbst programmieren können, aber sie sollten die richtigen Fragen stellen. Dafür ist der Austausch mit internen oder externen KI-Experten essenziell. Idealerweise findet dieser Dialog früh statt: bevor Systeme eingeführt werden. In gemischten Projektgruppen, Ethik-Boards oder bei Schulungen können Betriebsräte ihre Perspektive einbringen und von den Fachleuten lernen. Wichtig ist, dass technische Expertise und arbeitsrechtliche Sensibilität zusammenkommen. Denn die beste KI bringt nichts, wenn sie Vertrauen zerstört. Und genau da liegt die Chance: Wenn Betriebsräte, IT, HR und KI-Spezialisten gemeinsam arbeiten, entsteht eine Balance aus Innovation und Verantwortung. Wie schon gesagt: KI Einführung ist ein Kulturprojekt.
8. Welche KI gibt es FÜR den Betriebsrat?
Der Betriebsrat ist nicht nur Kontrollinstanz. Er kann selbst von KI profitieren. Tools wie betriebsrat.ai zeigen, wie das aussehen kann: Ob bei der Analyse von Texten, dem Entwurf von Betriebsvereinbarungen oder dem Sammeln von Argumenten für Gremiensitzungen.
Die KI kann Routineaufgaben erleichtern und den Kopf frei machen für das, was zählt: Dialog, Mitsprache, Gestaltung.
Wichtig dabei ist immer: Die Nutzung solcher Tools ersetzt kein arbeitsrechtliches oder strategisches Denken. Sie ergänzt es. Wer clever prüft, was KI für die eigene Arbeit leisten kann, schafft Freiräume. Und das ist gerade in einem Amt, das weit oft weit über vertraglichen Einsatz hinausreicht, ein echter Mehrwert.
9. Welche Vorteile bringt ein sozialpartnerschaftlicher Ansatz bei der KI-Einführung und -gestaltung?
Sozialpartnerschaft heißt: Wir gestalten gemeinsam. Das ist bei KI wichtiger denn je. Denn Technologie ist nicht neutral. Sie ist gestaltbar. Wenn Arbeitgeber, Betriebsrat und Beschäftigte an einem Tisch sitzen, entsteht Akzeptanz.
– Konflikte lassen sich vermeiden, Ängste abbauen.
– Gemeinsame Leitlinien, Pilotprojekte oder Ethik-Charts schaffen Vertrauen.
– Der Betriebsrat bringt die Perspektive der Belegschaft ein, Arbeitgeber die strategische Sicht – beides ist nötig.
Ein sozialpartnerschaftlicher Ansatz verhindert, dass KI von oben „verordnet“ wird. Stattdessen entsteht ein System, das zu den Werten passt, zur Kultur und zu den Menschen im Unternehmen. Das ist die Zukunft, die wir Menschen allein so oft bisher nicht geschafft haben – vielleicht auch, weil uns die Zeit gefehlt hat oder der Zwang. Das ist Auslegungssache ;-).
10. Was bringt die Zukunft in Sachen Betriebsrat und KI?
Die Zukunft ist hybrid auch für die Mitbestimmung. Betriebsräte werden verstärkt mit digitalen Tools arbeiten, sich vernetzen, dateninformiert argumentieren.
KI wird in Recruiting, Personalentwicklung, Schichtplanung, Arbeitsschutz oder im Performance Management eingesetzt werden (Vergleich auch Wenn Daten auf Dynamik treffen, https://britta-redmann.de/arbeitsrecht/wie-ki-und-agilitaet-das-performance-management-veraendern).
Wer hier nur reaktiv agiert, verpasst die Chance, Standards mitzugestalten. Deshalb sollten Betriebsräte jetzt schon Kompetenzen aufbauen, Betriebsvereinbarungen entwerfen und Pilotprojekte begleiten. Künftig werden hybride Gremienarbeit, der Einsatz eigener KI-Tools und die kontinuierliche Technologiefolgenabschätzung Teil der Betriebsratsarbeit sein.
Der Clou: Betriebsräte, die früh mitgestalten, können KI so implementieren, dass sie sowohl Effizienz als auch Bedürfnisorientierung in der Belegschaft steigert. Das macht sie nicht nur zur Kontrollinstanz, sondern zu aktiven Innovationstreibern.
Fazit
Mein Fazit nach vielen Workshops und Beratungen: KI kann Prozesse beschleunigen, Daten nutzbar machen und sogar die Arbeit erleichtern. Aber sie kann auch verunsichern, ausgrenzen oder überfordern, wenn wir sie falsch einführen.
Betriebsräte haben hier eine Schlüsselrolle.
Sie können verhindern, dass aus Innovation Überwachung wird und dafür sorgen, dass Technik den Menschen dient, nicht umgekehrt. Das gelingt, wenn wir früh ins Gespräch gehen, Rechte und Pflichten kennen und vor allem: gemeinsam gestalten.
Ich bin überzeugt: Die besten KI-Projekte entstehen dort, wo Betriebsrat, Arbeitgeber und Mitarbeitende an einem Tisch sitzen und gemeinsam gute Arbeit gestalten.